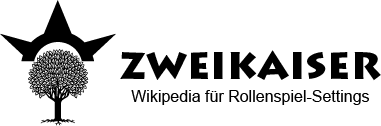Reichsstadt Ryborn
 |
 |
||
| Lage | Stadtherr | Reichsvogt | Stammsitz |
| Ryborn / Grafschaft Weser |
Claws Cronwell | xxx | xxx |
| Bürger | Beisassen | Sonstige Einwohner | Stadtwache |
| ca. 7.000 | ca. 14.000 | ca. 1.500 | ca. 400 Mann |
Ryborn ist als eines der wichtigsten Zentren des Handwerks Handels bekannt. Der Stolz der Bürger auf ihre noch recht junge Selbstverwaltung hat sich sowohl in der prächtigen Gestaltung der Gebäude niedergeschlagen als auch im allgemeinen Freiheitssinn der Ryborner. Gleichzeitig Der Ruf des Ryborner Handwerks wird bestimmt durch die große Zahl der dort lebenden, gut ausgebildeten Handwerksmeister, welche sich wegen der leicht verfügbaren und qualitativ hochwertigen Rohstoffe dort angesiedelt haben. Außergewöhnlich an Ryborn sind die dort ansässigen Zünfte, welche einen enormen politischen Einfluss haben und dafür sorgen, dass alle Bürger, die ein Handwerk ausüben, einer bestimmten Zunft beitreten müssen. Zunftlose Pfuscher werden oft von Schlägertrupps der Zünfte besucht.
Kurze Geschichte der Stadt
Ryborn gilt als eine der ersten Städte im Westen des Reiches. Sie ist älter als Andar, aber wuchs aufgrund des fehlenden Meerzuganges und der abgelegenen Lage inmitten des Ryborner Forstes weit weniger schnell. Jedoch etablierte sich Ryborn aufgrund der Lage und der guten Erreichbar von Rohstoffen aller Art als ein Zentrum des Handels und Handwerks. Dennoch war Ryborn lange Zeit keine wirklich reiche Stadt, denn das lange Zeit über die Region Weser herrschende Haus Bold forderte enorme Natural- und Geldabgaben von der Stadt. Jeder Versuch der Stadt, von der Krone das Reichsstadtsrecht zu erhalten und somit unabhängigkeit vom Adel zu sein, wurde von Haus Bold verhindert. Erst als das Haus Bold im Jahr 279 n.R. als Kronvasalle entmachtet wurde und das eher kleine und wenig ambitionierte Haus Leeb den Teil der Region zugesprochen bekam, in dem die Stadt Ryborn liegt, begann der wahre Aufschwung. Um das aus Leeb unter Druck zu setzen, wurden die Zünfte gegründet, welche aufgrund ihrer Marktmacht eine inoffizielle Unabhängigkeit der Stadt erwirken konnten. 371 n.R. beantragte die Stadt erneut das Reichsstadtrecht und 374 n.R. wurde es auch endgültig gewährt. Zu diesem Zeitpunkt wurde Haus Leeb bereits vom Haus Mers als Lehnsherr von Weser abgelöst. Die Gräfin Clea Mers von Weser versuchte die Unabhängigkeit zu verhindern, aber es gelang ihr nur, für ihr Haus einen dauerhaften Sitz im Stadtrat zu erwirken. Die Etablierung des Bürgertums und eines Stadtrates passierte schnell, da die Zünfte lange Zeit bereits einen Rat (ohne Rechtsgrundlage) hatten und sie gemeinsam mit angesehenen und vermögenden Einwohnern der Stadt jeden Zuzug in die Stadt bereits kontrollierten. Die privat finanzierte Stadtwache, welche bis dahin aus Söldnern bestand, wurde die offizielle Stadtwache und die Legitimierung von Ämtern und Verwaltungspositionen reine Formsache.
Der Stadtrat
| Mehr über die Hierarchie der Reichsstädte → Hierarchie einer Stadt |
Eine Besonderheit des Stadtrates von Ryborn ist, dass ratsfähigen Zünfte abhängig von ihrer Stärke jeweils einen oder mehrere Meister in den Rat entsenden, wobei jede Zunft nur eine Stimme besitzt. Die restlichen Ratsherren sind Kaufleute, Patrizier oder andere Bürger der Stadt, die entweder auf Grund ihrer Steuerlast dazu berechtigt sind oder aber dieses Vorrecht seit jeher genießen, wie das Adelshaus Mers, welches einen ständigen Sitz im Stadtrat hat, da die Stadt in der Domäne des Hauses liegt. Nicht im Rat vertreten sind nämlich trotz Bürgerrechts und ständiger Proteste die so genannten niederen Zünfte, wenngleich diese gelegentliche Fürsprecher finden.
Alle fünf Jahre wählt der Stadtrat den Stadtherren. Er ist der Vertreter der Stadt nach außen und führt den Vorsitz im Stadtrat. Zu seinen Aufgaben gehört es, die im Stadtrat gefassten Beschlüsse auszuführen, das Stadtsiegel als Zeichen der Handlungs- und Rechtsfähigkeit der Stadt zu führen und die Schlüssel der Stadttore aufzubewahren. Als Bürgermeister muss er zudem für die Sicherheit in seiner Stadt sorgen, Stadtfrieden gebieten und vor dem Reichsvogt und der Krone die Belange der Stadt vertreten.
Parteiensystem
Es ist üblich das sich die Ratsherren mit gleichen Ansichten und Anliegen zu teils ständigen Parteien zusammenschließen. Dadurch erhöht sich die Anzahl der fixen Stimmen für bestimmte Anliegen und Gesinnungen. Meistens stimmen dann die Parteimitglieder, obwohl etwas nicht zu 100% ihrer Interessensgruppe und Überzeugung entspricht, gemäß der Parteilinie ab. Innerhalb der Parteien wird natürlich abseits von Stadtrat gestritten und versucht ein gemeinsames Vorgehen zu finden. Die Parteien sind nicht offiziell anerkannt und haben eigentlich keine rechtliche Grundlage.
| Bezeichnung | Ratssitze | Beschreibung |
| Schwarzen | 4 | Zusammenschluss der Geldverleiher und einiger Kaufleute. sie werden so genannt, da schwarz die Farbe ist, welche für Reichtum steht. |
| Kaiserlichen | 1 | Zusammenschluss der meisten in Ryborn lebenden Adelsfamilien und dem Haus Mers |
| Eisernen | 3 | Zusammenschluss einiger Zünfte aus dem Bereich der Bearbeitung von Metallen und Erzen |
| Fortschrittlichen | 5 | Zusammenschluss von Händlern, Bürger, Bürger die für niedere Zünfte eintreten, Zunft der Gewandmacher, die eine Öffnung der Stadt herbeisehnen und das Zunftsystem hinterfragen. Sie sind auch die schärfsten Gegner des Adels, da sie die Zukunft im Bürgertum sehen. |
| Traditionalisten | 5 | Zusammenschluss vieler Handwerker, federführend ist die Zunft der Bergleute. Sie sind eher traditionsbewusste, adelstreue, welche die Entwicklung Ryborns oftmals mit Sorge und Spott verfolgen und nur zu gerne manches Rad zurückdrehen würden. |
| Fraktionslose | 9 | der Rest |
Ryborner Zünfte
Die zahlenmäßig größte Schicht in Ryborn-Stadt, stellen die Handwerker. Ihr Zusammenschlusse, die Zünfte, sind wohlhabend und einflussreich und im Stadtrat mit vier Ratsherren vertreten und dürfen jeweils in ihrem Handwerk eigene Gesetze aufstellen. Ryborn-Stadt ist die einzige Reichsstadt, welche die Bildung von Zünften erlaubt. Wobei diese Gesetze jederzeit durch den Stadtrichter (Rechtsverweser) aufgehoben werden könnten.
Der von den Zünften geforderte und durchgesetzte Zunftzwang bringt mit sich, dass alle Bürger, die ein Handwerk ausübten, einer bestimmten Zunft beitreten müssen. Gegen zunftlose Konkurrenten, die ‘Pfuscher’, die den alteingesessenen die Preise verderben, dürfen die Zünfte gemäß Stadtrechts mit Gewalt vorgehen. Die Zünfte haben die Pflicht, den Bürgern nur gute Waren für einen gerechten Preis anzubieten; vor allem aber sollen sie allen Mitgliedern das Auskommen sichern und Konkurrenz unterdrücken. Dazu regelt die Zunft die Tätigkeiten ihrer Mitglieder bis ins kleinste: So darf ein zünftiger Meister nicht länger als seine Kollegen arbeiten, nicht mehr Lehrlinge als vorgeschrieben beschäftigen, den Gesellen nicht höheren Lohn als vereinbart auszahlen und seine Waren nicht öffentlich anpreisen. Es wird sogar die die Höchstzahl der in einer Woche anzufertigenden Stücke festgeschrieben.
Um die Zahl der zugelassenen Handwerker und Werkstätten klein und damit die Preise hoch zu halten, steht die harte, vieljährige Ausbildung nur wenigen Lehrlingen offen, die dann Unfreie des Lehrmeisters werden. Nach der Prüfung und Freisprechung werden sie Gesellen, und die meisten bleiben das Zeit ihres Lebens. Das Leben der Gesellen ist dabei alles andere als leicht. Zwölf bis sechzehn Stunden Arbeit am Tag sind nicht ungewöhnlich, und der Lohn fällt oft so gering aus, dass er zuweilen kaum zum Überleben reicht. Außerdem ist den Gesellen verboten, zu heiraten und einen eigenen Hausstand zu gründen. Da es zudem meistens genügend Handwerksmeister in der Stadt gibt und jeder weitere nur die Verdienstmöglichkeiten der schon vorhandenen schmälern würde, versuchen die Zünfte, den Aufstieg zum Meister zu erschweren. So müssen Gesellen, die ihre Meisterprüfung ablegen wollen, oft folgende Bedingungen erfüllen: Sie müssen auf eigene Kosten ein Meisterstück anfertigen, sich einen eigenen Harnisch (Wehrpflicht der Bürger) für den Wachdienst kaufen, eine Meistergebühr in die Zunftkasse zahlen, Hausbesitz oder das dafür nötige Geld vorweisen und ein mehrgängiges Mahl für alle Meister der Zunft spenden. Nur selten wird einmal eine Werkstatt frei, so dass ein verdienter Geselle die Meisterprüfung ablegen kann. Die wenigen Meister aber sind die Herren der Zunft und wählen aus ihrer Mitte einen Vorsteher, der die Zunft nach außen vertritt, die Zunftakten und die Kasse, das Zunftbanner und -siegel verwahrt und über die Handwerker Gericht hält, wenn es um die inneren Angelegenheiten geht. Die Zunftordnung selbst muss immer vom Stadtrat und dem Stadtrichter bestätigt werden.
Die Handwerkszünfte begleiten den Handwerker auch außer der Arbeit: Bei festlichen Anlässen sind alle Meister mit ihren Familienangehörigen einzuladen, denn Geburtstage, Hochzeiten werden ebenso gemeinsam gefeiert wie auch Bestattungen. Invalide Meister und ihre Hinterbliebenen werden aus der Zunftkasse unterstützt, die von den Mitgliedern durch regelmäßige Zahlungen gefüllt wird. Zudem bildet jede Zunft eine Art Feuer- und Bürgerwehrtruppe, die im Kriegsfalle einen bestimmten Teil der Stadtmauer zu verteidigen hat. Der Brandschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt.
Ratsfähigen Zünfte
| Zunft | Größe | Partei | Anmerkung |
| Grob- und Hufschmiede | sehr groß | Traditionalisten | - |
| Waffenschmiede | mittelgroß | Eisernen | gespaltenes Verhältnis zu Grobschmieden, eitel |
| Gold- und Kunstschmiede | klein | Schwarzen | - |
| Tischler und Zimmerleute | mittelgroß | Fraktionslos | lebenslustig und gesellig, gelten als faul, viele Freunde – viele Feinde) |
| Drahtzieher | klein | Fraktionslos | - |
| Metzger und Schlachtern | klein | Fraktionslos | - |
| Bronzegießer und Rotschmiede | mittelgroß | Eisernen | - |
| Kesselflicker | mittelgroß | Fraktionslos | - |
| Steinmetze und Baumeister | groß | Fortschrittlichen | fühlen sich gegenüber Grobschmieden und Bergleuten benachteiligt |
| Bergleute | sehr groß | Traditionalisten | sehr großer Zusammenhalt |
| Schuster | mittelgroß | Fortschrittlichen | gute Beziehungen zu Metzgern und Schlachtern |
| Glaser | winzig | Schwarzen | Elitär, für Auswärtige gesperrt, keine Gesellenwanderjahre |
| Gewandmacher | klein | Traditionalisten | wechselnde Allianzen, gespaltene Zunft, Zugehörigkeit erkennbar an der Mode |
| Gewandmacher | klein | Fortschrittlichen | wechselnde Allianzen, gespaltene Zunft, Zugehörigkeit erkennbar an der Mode |
| Wirte und Brauer | sehr groß | Fraktionslos | vermitteln zwischen Lagern |
| Fuhrleute | mittelgroß | Traditionalisten | - |
| Schlosser | mittelgroß | Fortschrittlichen | - |
| Färber | mittelgroß | Fraktionslos | - |
| Bäcker | mittelgroß | Fraktionslos | - |
| Seiler | klein | Fraktionslos | - |
| Geldverleiher | klein | Schwarzen | trotz weniger Mitglieder, eine mächtige Zunft mit viel Einfluss |
Niederen Zünfte
| Zunft | Größe | Anmerkung |
| Apotheker und Bader | klein | - |
| Kurtisanen | winzig | - |
| Schreiber | klein | - |
| Kleinkrämer | groß | fortschrittlich, geschätzt aber ohne Verbündete |
| Fährleute und Fischer | mittelgroß | arm aber stolz, machen häufig durch Proteste von sich reden |
| Gerber | mittelgroß | unbeliebt |
Ansiedelung
Anders als zb. in Andar, wo der Stadtrat die Ansiedlung in Stadt und Mark gestattet, geht Ryborn rigide mit Ankömmlingen um. Der Rat erlaubt hauptsächlich solchen Flüchtlingen die Ansiedlung als Beisassen, die der Stadt ein Bleibegeld entrichtet oder einen Dienst erwiesen haben oder von denen sie künftig profitieren kann. Anderen bleibt die Ausübung ihres Handwerks auf Druck der Zünfte verboten, die keine Konkurrenz dulden. Ihnen bleibt, wie ehemaligen Freibauern, nur die Hoffnung, dass ihnen ein milde gesonnener einheimischer Bürger einen Flecken Land zur Verfügung stellt oder angestellt wird, von dem sie sich und ihre Familien als Beisassen ernähren können. Gänzlich mittellose Flüchtlinge, Krüppel und Bettler sind in Ryborn nicht gern gesehen. Denn so freundlich und geschäftig, adrett und ordentlich Ryborn jedem Durchreisenden dünkt: Mit jenen, die länger als nur für die Warenschau oder ein paar Tage bleiben wollen, mit jenen gar, die sich in Ryborn niederlassen wollen, springen die Ryborner nicht so freundlich um.
Konflikte & Bündnisse
Ryborn ist in der glücklichen Lage keine wirklichen Feinde zu haben. Mit dem in Weser herrschenden Haus Mers gibt es nach anfänglichen Schwierigkeiten ein gutes Auskommen. Da die Tradionalisten im Stadtrat derzeit die Überhand haben und mit den Kaiserlichen kooperieren gibt man dem örtlichen Adel auch keinen Anlass der Stadt große Aufmerksamkeit zu schenken. Solange alle ihr Geld verdienen und von der Stadt profitieren wird sich dies auch nicht ändern.
Jedoch gibt es auch Punkte, welche die Stadtpolitik sehr wohl beschäftigen. Haus Mers hat sich gerüchteweise mit deren Lehnsherren, Haus Lasar zerstritten. Sollte diese Situation eskalieren, könnte Haus Bold die Gunst der Stunde nutzen um erneut die Region Ryborn zu beanspruchen - der 100 Jahre gültige Vertrag, in welchem Haus Bold auf den eigentlich legitimen Anspruch auf des Kronlehen Ryborn verzichtet, lief im Februar 379 n.R. aus. Natürlich entscheidet eine Vergabe eines Kronlehens letztlich die Krone, aber sowohl Haus Mers als auch Haus Lasar stehen derzeit nicht wirklich in der Gunst der Krone. Im Gegensatz zu Haus Bold, sind beide Häuser der Westallianz beigetreten. Für die Stadt wäre die Rückkehr des Hauses Bold das eine Katastrophe, da dieses damit wieder sehr viel Einfluss auf die Stadt hätte und deren ständige Forderung auf Rückerstattung der verlorenen Besitzungen innerhalb der Stadt, sehr viel mehr Nachdruck verleihen könnte.
In der benachbarten und für den Handel sehr wichtigen Südmark sieht es so aus, als ob es zwischen Haus Ingelsheim und Haus Reichern zu einem bewaffneten Konflikt kommen könnte. Dies würd eine Unterbrechung des Handels bedeuten und auch, dass Kriegsflüchtlinge die Nähe zur Stadt suchen.
Wirtschaft
Militär
Interessantes über die Stadt
Stadtviertel
 Die meisten Reisenden gelangen auf der Reichsstraße nach Ryborn, entweder von Süden aus der Südmark oder vom Norden aus West-Elasura. Die Stadt liegt mitten im Wald, ist aber von einem fast 1km breiten, gerodeten Bereich umgeben. Noch bevor man die Stadt erblickt, wird man der graublauen Rauchfahnen gewahr, die aus den zahlreichen
Schornsteinen, Essen und gastlichen Herdfeuern aufsteigen. Je nach Windrichtung und Tageszeit hört man das eifrige Hämmern und Hantieren der Werkstätten. Betritt man die Stadt durch eines der fünf Stadttore betritt, wird man zuerst Bekanntschaft mit den Mauerwachen machen, die die Fremden bald freundlich begrüßen, bald
misstrauisch mustern, je nach ihrem Äußeren und ihrem Gebaren. Was die Mitnahme von Waffen angeht, entscheiden die Wächter nach Augenmaß und Stadtrecht.
Die meisten Reisenden gelangen auf der Reichsstraße nach Ryborn, entweder von Süden aus der Südmark oder vom Norden aus West-Elasura. Die Stadt liegt mitten im Wald, ist aber von einem fast 1km breiten, gerodeten Bereich umgeben. Noch bevor man die Stadt erblickt, wird man der graublauen Rauchfahnen gewahr, die aus den zahlreichen
Schornsteinen, Essen und gastlichen Herdfeuern aufsteigen. Je nach Windrichtung und Tageszeit hört man das eifrige Hämmern und Hantieren der Werkstätten. Betritt man die Stadt durch eines der fünf Stadttore betritt, wird man zuerst Bekanntschaft mit den Mauerwachen machen, die die Fremden bald freundlich begrüßen, bald
misstrauisch mustern, je nach ihrem Äußeren und ihrem Gebaren. Was die Mitnahme von Waffen angeht, entscheiden die Wächter nach Augenmaß und Stadtrecht.
Alt-Ryborn
Auf einem Hügel liegt Alt-Ryborn, das älteste Viertel der Stadt. In den von alten Trutzmauern umgebenen, engen und verwinkelten Gassen leben viele alteingesessene Familien, das Viertel gilt als gutbürgerlich. Der Hügel wird von der Forstwacht, einer Zwingburg (1) welche früher der Stammsitz des Hauses Bold war und heute den Stadtrat und Teile der Verwaltung beheimatet, gekrönt. ebenfalls in Alt-Ryborn befindet sich das Gerichtsgebäude der Stadt (3) und die größte Kaserne der Stadtwache (2).
Die Ehre, die man dem Namensgeber des in Alt-Ryborn gelegenen Stiegl-Brunnens (8) zuteil werden ließ, ist durchaus zweifelhafter Natur: Conrad Stiegl war ein Rivaner Brauer, dessen Bier, wässrig, fad und manchmal sauer war. Als Strafe hieß man ihn, einen Brunnen zu stiften, in dem man ihn künftig taufen wolle, wenn er nicht besseres Handwerk abliefere. Stiegel besann sich. Nicht ein einziges Mal musste man die Schandstrafe gegen ihn verhängen. Seitdem aber werden im Brunnenbecken all jene Handwerker untergetaucht und dem Spott der Mitbürger preisgegeben, die schlampig arbeiten und gegen die gute Ordnung verstoßen. Vor einigen Jahren hat man hier zudem einen Pranger mit Schandkäfig errichtet, um auch andere Leibstrafen zu vollziehen.
Angerviertel
Im Norden und Osten von Alt-Ryborn liegt das Angerviertel, welches das größte Viertel der Stadt ist. Das Angerviertel hat seinen Namen von einem Anger (4), also einem offenen Platz. Es ist die Heimstatt der einfachen Handwerker, der Fleischhauer und Bäcker, der Schreiner und Schmiede, Böttcher, Brauer und all jener, die die Stadt mit dem Notwendigen versorgen. Die Häuser sind einfach und bescheiden, bisweilen teilen sich mehrere Familien und Gewerke eine Parzelle, leben im Vorder- und im Hinterhaus, teilen Abtritt und Hof. Steinhäuser sind hier eine Seltenheit, nur einige Handwerker, bei denen wegen der Brandgefahr ein Steinbau vorgeschrieben ist, leisten sich diesen Luxus Wohnhaus und Werkstätten sind meist unter einem Dach zu finden – manche müssen nur den Laden ihres Fensters herunterklappen, um dort die Früchte ihrer Arbeit feilzubieten. Viele Handwerker verlegen ihre Arbeit gleich auf die Straße: Besenbinder und Drahtzieher hocken auf Schemeln vor ihren Häusern. Unweit der Stadtmauern, welche das angerviertel zum Umland der Stadt hin abgrenzen, trifft man auf Bauernhöfe. Nur die Weiden und Felder befinden sich vor den Toren, denn die Behausungen der Städter drängen sich längst dicht um die Höfe. Die Straßen riechen übel, sind schmutzig und mit Unrat bedeckt, hier gibt es keine Rinnsteine, um Regenwasser und Abfälle in den Fluss zu spülen. Schweine, Hühner und anderes Kleinvieh bevölkern die Gassen, denn auch viele einfache Leute halten sich etwas Vieh, um den eintönigen, kargen Speisezettel an Festtagen aufzubessern. Über den Bach der durch das Angerviertel fließt, führt die „Goldene Brücke“ (5), eine reich verzierte Steinbrücke die gelb bemalt ist und von der Zunft der Steinmetze und Baumeister gestiftet wurde.
Meilerstatt
Zwischen dem rechten Ufer der Tiba und den anderen Stadtvierteln, liegt Meilerstatt, das Viertel der Werkstätten und Großbetriebe so mancher Zunftmitglieder. Hier geht es tagsüber geschäftig und laut zu, die Luft ist rauchig und erfüllt vom Lärm der Betriebe. Ruhe kehrt erst nach dem Abendgeläut ein. Wegen der hohen Brandgefahr ist in Meilerstatt vieles aus Stein erbaut, die Dächer sind mit Schindeln gedeckt; auch die Straßen sind gepflastert, damit die schweren Fuhrwagen bei Regenwetter nicht im Straßenschlamm stecken bleiben. Meist weht der Süd- oder Westwind die Rauchwolken aus der Stadt hinaus, nur selten wird der Qualm in die Altstadt oder in das Südquartier getragen. Je näher man zum Ufer der Tiba kommt, desto dichter werden die eher einfachen Wohngebäude jener Handwerker die zu wenig Geld haben um sich im Südquartier anzusiedeln. Hier wird schnell deutlich, dass der Wohlstand, der in Ryborn unter den Handwerkern herrscht, nicht Allen zuteil wird. Direkt am Ufer haben sich viele Fischer angesiedelt.
Durch Meilerstatt führt die Reichsstraße, welche über das befestigte Nordtor (6) in die Stadt führt. Das Stadtviertel wird durch einen Bach in zwei Hälften geteilt und es gibt etliche Holzbrücken die das Überqueren möglich machen. Nur die Reichsstraße überquert den Bach mit einer großen Steinbrücke (7). Mitten in Meilerstatt ist auch das Amtsgebäude der Kammer für Reichsgut und Handel (11).
Südquartier
Der Marktplatz (14) des Südquartiers ist das merkantile Herz der Stadt. Durch das Viertel führt die Reichsstrasse, welche durch eine große, schwer befestigte Toranlage die Stadt verlässt. Alltags reihen sich die Stände dort dicht an dicht, bieten Kaufleute, Krämer und Tändler, Gemüsehändler, Brauer, Bauern und Metzger ihre Waren im Schatten der imposanten Bürgerhäuser feil. Bedienstete stehen schwatzend am Marktbrunnen, die Körbe mit Besorgungen achtlos neben sich gestellt. Zwei Gebäude dominieren den Marktplatz, zum einen die prachtvolle Zunfthalle (15), Versammlungsort der Zünfte, erbaut durch die reichen Spenden der Zunftmitglieder; nicht minder imposant die benachbarte Markthalle (16), ein Bau mit Arkaden und Galerie: gleichsam zwei Stätten, an denen dem Wohlstand auf ganz eigene Weise gehuldigt wird. In der Nachbarschaft des Markplatzes und figurenverzierten Bürgerhäusern befinden sich die Kontoren der reichen Händler und die „Goldene Stube“ (17), ein der Zunft der Geldverleiher und ihren Gästen vorbehaltenes Lokal mit einem prunkvollen Festsaal.
Nicht nur Kaufleute, auch Handwerker prägen das Bild. Allerdings sind es keine Grobschmiede, Metzger und Flickschneider, die hier ihre Wohn- und Werkstatt haben, sondern die nobleren Vertreter der handwerklichen Künste: Perlmuttschleifer und -schneider, Handschuhmacher, Kürschner und Apotheker, Putz- und Gewandmacher und anderes edle Handwerk. Weite Teile des Viertels sind gepflastert, selbst der Marktplatz ist mit Steinen ausgelegt, nicht jedoch die Gassen in Ufernähe und an der Mauer.
Ebenfalls im Südquartier befindet sich das Amtsgebäude der Rechtsverweserei (18) und der angeschlossenen Kaserne der Reichsgarde. Das eigentliche Gerichtsgebäude liegt jedoch in Alt-Ryborn (3). Der grün verputzte, türmchengeschmückte Bau beherbergt auch den Sitz des Reichsvogts.
Westquartier
Handwerker, deren Gewerke die Bürger nur ungern in ihrer Nachbarschaft dulden wollen, da sie mit Lärm daher kommen oder Dreck und Gestank verursachen, hat man auf die andere, die „schlechte“ Tibaseite gedrängt. Es führen jedoch zwei, durch Tore versperrbare Steinbrücken (10) über die Tiba und verbinden so die West- mit der Ostsseite der Stadt. Gerber, Teer-, Pech- sowie Salzsieder, Färber, Walker und Filzer, sie alle haben sich im Westquartier, welches oft nur „Quartier“ genannt wird, niedergelassen. Selbst die Seiler gehen ihrem Gewerbe nicht mehr in der Meilerstatt nach, seitdem ihnen gutes Geld für ihr Gelände angeboten wurde. Das Viertel wurde ganz selbstverständlich einer der ersten Anlaufpunkte für Landflüchtige und Glücksritter die fälschlicherweise meinen, dass das Leben in der Stadt ihnen ein besseres Leben ermöglicht. Die so wachsende Zahl der Verarmten und Elenden, die buchstäblich auf der Straße liegen, wird zur zusätzlichen Belastung. Etliche Menschen sind mit Kind und Kegel in die Stadt gekommen, und können doch kaum ihr eigenes Maul stopfen. Diese armen Seelen haben häufig kein Dach über dem Kopf; das wenige, was ihnen gehört, tragen sie am Leib. Raub und Totschlag sind unter diesen armen Seelen, keine Seltenheit, wenn nicht Kälte und Krankheit oder die harte Arbeit sie ohnedies dahinraffen.
Im Westquartier befindet sich auch die einzige, sehr einfach gestaltete und beinahe schon unaufällige Brigonskirche (12). Erbaut wurde sic durch Spenden der Anwohner des Westquartiers. Direkt an die Kirche angeschlossen ist eine Armenspeisung und ein Armenspital, welche von der Brigonskirche betrieben und erhalten werden. Vor einiger Zeit kaufte Hagen Seilern, der Sprecher der Geldverleiher im Stadtrat, das nach dem Niedergang der Asgarn Hanse (siehe Handelshaus Asgarn) leerstehende Bordell und Spielhaus „Neue Zeiten“ (13). Er renovierte das das zweistöckige Holzgebäude (mit Galerie im Obergeschoss) und wiedereröffnete den Spielsalon mit Bordell. Insbesondere Glücksspiele sind der große Renner.